Was ist DGS?
Kurz und knackig lässt es sich so formulieren: Die deutsche Gebärdensprache (kurz: DGS) ist die visuell-wahrnehmbare Sprache, mit der gehörlose und schwerhörige Personen in Deutschland miteinander kommunizieren.
Und das überrascht dich vielleicht erst einmal aber DGS, wie auch die Gebärdensprachen, die in anderen Ländern verwendet werden, sind vollwertige eigenständige Sprachen, mit denen man wirklich alles erzählen kann – ganz egal, ob man mit seinen Freunden rumalbert oder Quantenphysik erklärt. Die deutsche Gebärdensprache gibt nicht einfach die gesprochene Sprache Wort für Wort wieder. Sie folgt einer eigenständigen Grammatik und Struktur, welche sich grundlegend von der der deutschen Lautsprache unterscheidet.
Gebärdensprachen sind die einzigen dreidimensionalen Sprachen überhaupt. Gedanken und Sachverhalte werden hauptsächlich mit den Händen ausgedrückt, wobei Körperhaltung und Mimik auch eine große Rolle spielen.
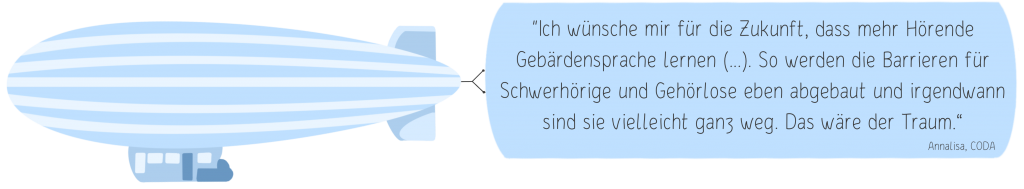
Wichtige Begriffe erklärt
Gebärdensprache
Gebärdensprachen sind visuell-wahrnehmbare Sprachen, die den Lautsprachen in allen linguistischen Aspekten ebenbürtig sind. Sie sind keine Übersetzungen, der in dem Land gesprochenen Lautsprachen, sondern eigenständige Sprachen mit eigener Grammatik. Sie werden vor allem von Gehörlosen und Schwerhörigen verwendet.
Zeichensprache
Zeichensprachen sind nichtlautsprachliche Verständigungssysteme zur Kommunikation. Beispiele sind Unterwasserzeichen von Tauchern oder auch Signalsprachen von Verkehrszeichen. Oft werden diese auch begleitend zu einer Lautsprache verwendet. Gebärdensprachen werden oft fälschlicherweise als Zeichensprachen bezeichnet, was natürlich diesen wie wir oben gesehen haben, nicht ansatzweise gerecht wird. Eigentlich sind Zeichensprachen, deshalb auch keine echten Sprachen, da diese eine eigene Grammatik und Semantik haben müssten.
Fingeralphabet
Mit dem Fingeralphabet kann man mit Hilfe nur einer Hand die Schreibweise eines Wortes buchstabieren. Das Fingeralphabet wird in der Gebärdensprache genutzt, um Eigennamen oder Wörter, die noch keine Gebärde haben zu buchstabieren.
LBG – Lautsprachbegleitende Gebärden
Bei lautsprachbegleitenden Gebärden werden die gesprochenen Wörter eins zu eins in Gebärden übersetzt. Es ist quasi eine Reduktion der Gebärdensprache auf die einzelnen Gebärden, die nun der Grammatik der jeweiligen Lautsprache folgen. Im Deutschen ist es also Deutsch eins zu eins in Gebärden übersetzt. In den meisten Fällen kommt LBG bei schwerhörigen oder ertaubten Menschen zum Einsatz. Dass Gehörlose, von Geburt an LBG lernen, kommt selten vor.
LUG – Lautsprachunterstützende Gebärden
Da es in der Praxis nicht immer möglich ist schnell gesprochenen Text in LBG zu übersetzen, werden oft lautsprachunterstützende Gebärden eingesetzt. Dabei werden dann einzelne Zeichen oder Flexionen weggelassen, um es einfacher und verständlicher zu machen. Diese wird vor allem von Lehrern im Unterricht benutzt, die nicht in DGS sondern in Lautsprache unterrichten.
Gehörlos/ Taub / ”deaf”
All dies sind Begriffe, mit denen sich Menschen mit einer Höreinschränkung , bezeichnen.
Doch welchen Begriff solltest du eigentlich verwenden? In der DGS gibt es für diese drei unterschiedlichen Bezeichnungen nur eine einzige Gebärde, die meist einfachheitshalber ohne Mundbild verwendet wird. Doch wie gehe ich damit in der Lautsprache respektvoll um?
In der Vergangenheit hat man versucht mit “gehörlos” ein positives Wort zu etablieren und man hat gelernt, diesen Begriff zu verwenden. Heutzutage ist es nicht mehr so eindeutig und “Gehörlos” wird manchmal sogar abgelehnt. Tendenziell wird “Taub” in der Diskussion von den Betroffenen momentan bevorzugt. Innerhalb der Community bezeichnen sich auch einige mit dem englischen Begriff “deaf”.
ALLE sind sich jedoch einig, dass “Taubstumm” absolut abwertend ist und sogar als Beleidigung verstanden wird.
Daher fragt die betroffene Person am besten freundlich nach der bevorzugten Bezeichnung.
CODA
CODA ist eine englische Abkürzung für Children of Deaf Adults (=Kinder gehörloser Eltern). Sie selbst sind also hörend, haben aber gehörlose Eltern. CODAs wachsen also in zwei unterschiedlichen Sprachen und auch Kulturen auf.
Das ist jedoch recht selten. 90% der gehörlosen Kinder, haben hörende Eltern.
Cochlea-Implantat (CI)
Das Cochlea-Implantat ist eine Hörprothese für Gehörlose und Ertaubte, deren Hörnerv noch funktionsfähig ist. Es kann dann eine Möglichkeit sein, wenn ein herkömmliches schallverstärkendes Hörgerät kein ausreichendes Sprachverstehen mehr erzielt. Dabei wird eine Komponente hinterm Ohr am Schädel implantiert und an den Hörnerv angeschlossen und eine zweite Komponente von außen auf der Haut über eine magnetische Verbindung aufgesetzt.
Ein CI beseitigt nicht die Taubheit. Implantierte erleben die Resultate des CI’s dabei sehr unterschiedlich. Während die einen damit sogar relativ gut telefonieren können, bringt das Implantat für andere kaum Sprachverständnis.
Es ist nicht für jeden mit einer Hörschädigung eine Lösung.
Gehörlosenkultur
Gehörlosigkeit bedeutet mehr als nur ein Leben ohne Hören. Denn bei einer hörenden Mehrheit ist auch die Kommunikation und Verständigung in der Gesellschaft auf akustische Signale ausgelegt. Denken wir allein an Warnsysteme. Das schließt Gehörlose unbeabsichtigt oft aus, so dass Gehörlose eher den Kontakt ihresgleichen suchen, wo sie sich ungehindert in ihrer bevorzugten Sprache verständigen können und ein Ort der Geborgenheit finden. Und dadurch entsteht natürlich neben der Sprache auch eine eigenständige Kultur.
Die Gebärdensprache ist dabei ein wesentlicher Bestandteil. Sie ist nicht nur Hauptkommunikation, sondern auch Teil einer künstlerischen Ausdrucksweise. Ob Gedicht, Tanz oder bildende Kunst – Gebärdensprache zeigt sich dort nochmals auf eine ganz neue, kreative und sinnliche Art. Aber Kulturen zeichnen sich ja auch durch kleinere im Alltag erkennbare Rituale aus. Zum Beispiel unterhält man sich in Gebärden tendenziell offener und persönlicher als es Hörende in Lautsprache machen würden. Auch ist eine große Gastfreundschaft Teil der gehörlosen Gemeinschaft. Aber wir sind uns sicher, dass du noch einiges mehr über die Gehörlosenkultur herausfinden wirst, wenn du dich selbst mit Gehörlosen triffst.
